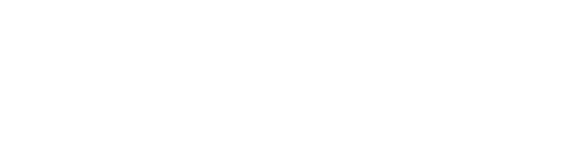if you enter the space
das Geräusch vom Kühlschrank hat Schwankungen | 2023 | installation for room, mixed media
exhibition: the waters you touched, now turned to concrete (with Gökçen Dilek Acay + Nina Röder) |2023 | HAUNT Berlin (with EIGENHEIM Weimar/Berlin)
wir stehen auf einem weißen Blatt | 2023 | EIGENHEIM Weimar/Berlin | artKarlsruhe
sea should be effortless/ Variation für Stuckraum
exhibition: Zwischenwelten | 2023 | Kunstmuseum Erlangen
tiny are the walls and flat is the roof | 2022 | Galerie Schlichtenmaier | Stuttgart
with heavily bodies we float | 2022 | Rutger Brandt Gallery | Amsterdam
the truce of fragile| 2021 | EIGENHEIM Berlin

video walk through | the truce of fragile
installation | 2021 | a room buildt of paper and wood, inside: videos, sound, painting, found objects, special cooperation with trash&trasher (2021/ EIGENHEIM Berlin)
der Weg alles Zeitlichen | 2018 | Spinnerei archiv massiv | Leipzig
out-takes
text
Hier muss der Ort sein.
Wo Nebel, träge Walze, rollt, fast mürrisch davonwatet, zieht den Schleier ab.
Mit sich. Nachgeben ist das, ganz unverhohlen.
Zieht, einfach, eine lange geschliffene Kante; keine Kante, ein willkommenes Schubsen?
Ein Schritt! Für uns Gegangener.
Hier muss der Ort sein.
Und, soweit ich weiss, ist das wundervoll.
Dem Wind ist egal über wen er streicht. Der Atem der Erinnerung schaukelt, zum
Klang einer Insel, Atoll ohne Aufgabe. Singt, füllt, füllt sogar den Wind.
Dem Licht ist egal auf was es fällt.
Berstprall schon, dicht und dann verdampft.
Nach dem Schleier randscharfer Farbschmerz; anfangs.
Jetzt ankommen und hinlegen. An diese Bucht des Wachstums.
Definierte Grenzenlosigkeit. Trägt. Hierher. Genau dieser Ort.